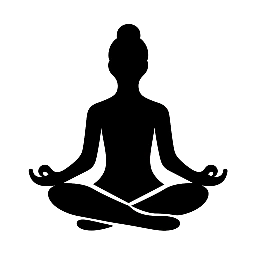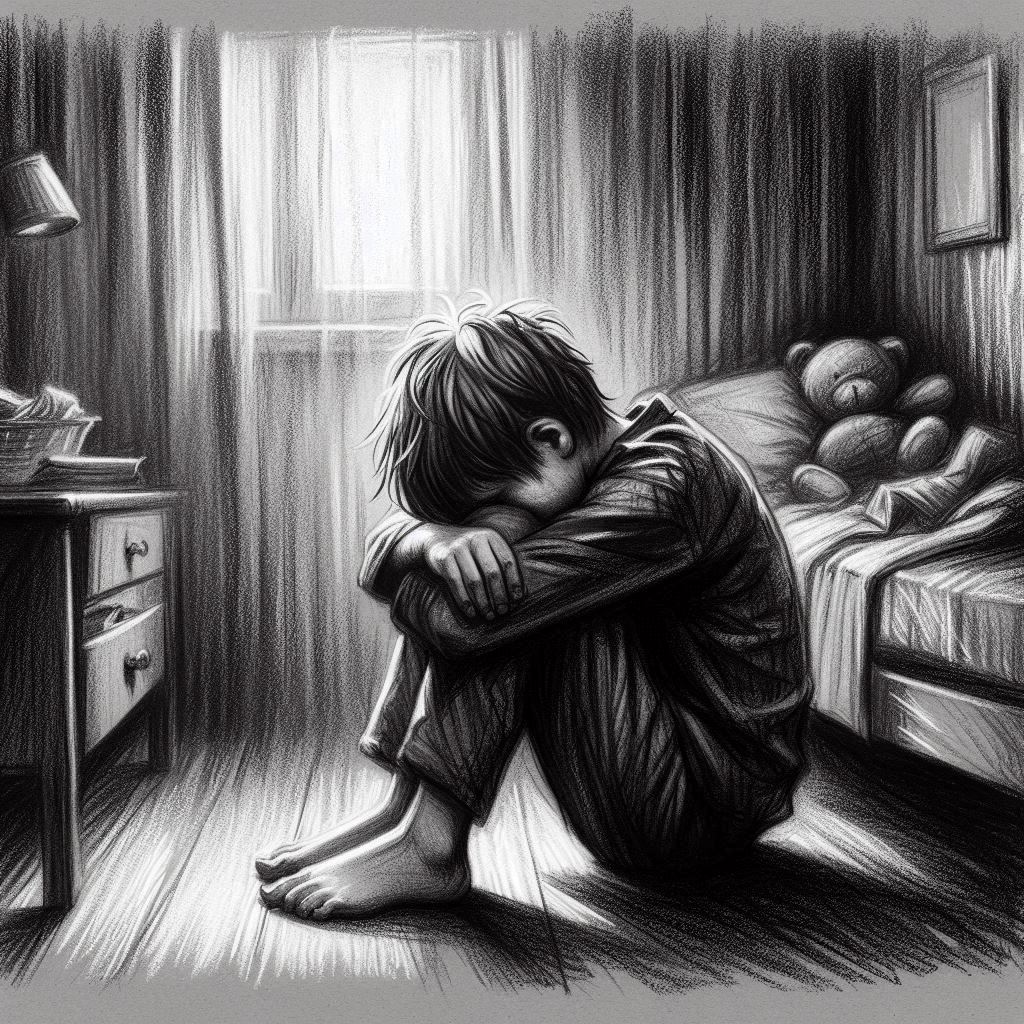kPTBS ist die Abkürzung für komplexe Posttraumatische Belastungsstörung und wird neu im ICD 11 als eigenständige Diagnose aufgeführt (6B41).
Es handelt sich hierbei um eine Traumfolgestörung, die auftreten kann, wenn langanhaltende oder über einen längeren Zeitraum wiederkehrende traumatische Ereignisse stattfinden. Beispiele hierfür sind häusliche Gewalt in der Kindheit oder in der Beziehung, wiederholter Missbrauch, Folter und Mobbing. Hier kann man bereits den Unterschied zur Posttraumatischen Belastungsstörung, kurz PTBS, erkennen. Eine PTBS entsteht durch ein einmaliges, einschlägiges Ereignis, während wir bei der komplexen PTBS von einem Ereignis sprechen, das sich über einen längeren Zeitraum erstreckt.
Ich werde im Nachfolgenden auf die Definition nach dem ICD 11 eingehen.
Symptome nach ICD 11
- Alle Symptome der PTBS sind erfüllt:
- Wiedererleben des traumatischen Ereignisse durch Flashbacks, Albträumen, intrusive (sich aufdrängende) Gedanken. Das Wiedererleben kann sich über eine oder mehrere Sinne zeigen und geht typischerweise mit intensiven Emotionen oder körperlichen Empfindungen einher.
- Vermeidung von Gedanken, Aktivitäten, Situationen oder Personen, die an das Ereignis erinnern.
- anhaltendes Gefühl bedroht zu sein, das sich beispielsweise durch Hypervigilanz (erhöhte Wachsamkeit), oder verstärkte Schreckhaftigkeit zeigen kann.
- Die Symptome halten mindestens mehrere Wochen lang an und verursachen bedeutsame Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, ausbildungsbezogenen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.
- Probleme die Emotionen regulieren zu können. Das zeigt sich beispielsweise über häufige und intensive Wutausbrüche, übermäßige Reizbarkeit oder Schwierigkeiten Frustration zu tolerieren. Aber auch Unterdrückung von Emotionen und ein Gefühl der Leere können dazuzählen.
- Vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstbild, beispielsweise durch ein Gefühl, erniedrigt, unterlegen oder wertlos zu sein, sowie Schamgefühle, Schuldgefühle und Versagensgefühle im Zusammenhang mit dem traumatischen Ereignis.
- Schwierigkeiten, Beziehungen aufrechtzuerhalten und sich Anderen nahe zu fühlen, überhöhtes Misstrauen gegenüber anderen.
- Diese Symptome führen zu bedeutsamen Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, ausbildungsbezogenen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.
Komorbide Erkrankungen
Die Autoren Luise Reddemann und Wolfgang Wöller des Buches „Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung“ (1) legen darin nahe, dass die Bezeichnung Komorbidität bei Traumafolgestörungen mit Vorsicht zu genießen sei. Es handle sich hierbei weniger um eigenständige Erkrankungen und seien vielmehr ein andersartiger Ausdruck einer Traumatisierung. Sie listen in ihrem Buch dennoch einige Störungsbilder auf, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 88% bei den Männern und 79% bei den Frauen mit der kPTBS einhergehen:
- depressive Störungen
- Substanzmissbrauch und Abhängigkeit
- Angsterkrankungen
- Essstörungen
- Persönlichkeitsstörungen
- Zwangssymptome
Differenzialdiagnostik
Die kPTBS ähnelt der Symptomatik von Borderline und ADHS, weshalb es hierbei gehäuft zu Fehldiagnosen kommt oder Störungsbilder übersehen werden. Es ist möglich gleichzeitig Borderline, kPTBS und ADHS haben. Betroffene von ADHS scheinen laut Studien zufolge häufiger von PTBS betroffen zu sein. (2) Eine ausführlichei Differenzialdiagnostik ist daher unerlässlich.
Therapie
Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man eine kPTBS behandeln kann. Nachfolgend liste ich die gängigsten Methoden auf:
- Trauma fokussierte kognitive Verhaltenstherapie (TF-CBT) Eine Methode, bei der Patienten lernen, ihre Gedanken und Gefühle im Zusammenhang mit dem Trauma zu verändern und ihre Angst zu reduzieren.
- Traumaspezifische Psychotherapie Dient zur Verarbeitung der traumatischen Erinnerungen und zur Bewältigung von Flashbacks, Angst und sozialer Isolation. Hierzu muss man stabil sein.
- Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Wirksame Methode, die bilaterale Stimulation (z.B. Augenbewegungen) einsetzt, um das Trauma zu verarbeiten.
- Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT) Hilft, Emotionen zu regulieren, soziale Fähigkeiten zu verbessern und mit schwierigen Situationen umzugehen (wird häufig bei Borderline eingesetzt).
- Psychodynamisch Imaginative Trauma Therapie (PITT) Ein psychodynamischer Ansatz, der auf der Verarbeitung von traumatischen Erfahrungen im inneren Bild basiert.
- Ego-State-Therapie und Internal Family Systems (IFS) Diese Methode konzentriert sich auf die Arbeit mit inneren Anteilen oder Persönlichkeitsteilen, um Konflikte zu lösen und zu integrieren.
- Somatic Experiencing (SE) Diese Körpertherapie konzentriert sich auf die Wahrnehmung und Verarbeitung von körperlichen Spannungen und Emotionen im Zusammenhang mit dem Trauma.
- Ergotherapie, Kunsttherapie, Musiktherapie, Körper- und Bewegungstherapie Ergänzen die psychotherapeutischen Ansätze und helfen bei der Bewältigung körperlicher und emotionaler Symptome.
Meine persönliche Erfahrung mit der Diagnostik
Meine Diagnose kPTBS (inklusive Differenzialdiagnostik) bekam ich im Rahmen meiner kognitiven Verhaltenstherapie im Jahr 2024. Damit wurde meine bisherige Diagnose Borderline korrigiert. Für die ADHS Diagnostik begab ich mich in einer Praxis, die sich darauf spezialisiert hatte und bekam die Diagnose im Februar 2025. Aktuell warte ich noch auf die Diagnostik für Autismus.
Auch ich habe also die Erfahrung gemacht, dass es schwierig ist, die richtige Diagnose und damit das richtige Behandlungskonzept zu erhalten. Erschwerend kam hinzu, dass ich die Borderline Diagnose vor etwa 15 Jahren erhielt und die Vorurteile darüber zu dieser Zeit enorm waren. Mit Borderline galt man als „unbehandelbar“ und „hysterisch“. Das führte dazu, dass man mich nicht ernst genommen hatte. Zu diesem Zeitpunkt war das absolut verheerend, da dies zum Nachteil meiner Tochter geschah und sie damit zusätzlich in Gefahr gebracht wurde. Hierzu gehe ich eventuell in einem anderen Post noch ein.
Als ich vor einem Jahr aktiv in Online-Foren zur Selbsthilfe unterwegs war und auch aktuell in meiner Öffentlichkeitsarbeit auf Social Media bekomme ich ähnliche Rückmeldungen von Betroffenen mit Traumatisierungen. Die häufigst gestellte Diagnose war und ist vermutlich noch immer Borderline. Auch hier möchte ich in einem eigenen Beitrag für Borderline näher darauf eingehen, aber ich möchte an der Stelle dennoch erwähnen, dass die Vorschnelle falsche Diagnose Borderline dazu führt, dass das eigentliche Krankheitsbild nicht mehr genügend ernst genommen wird und durch das Übersehen der eigentlichen Störung bekommt der Patient nicht ausreichend Hilfe.
Ein weiteres Thema ist ADHS. Ich musste erst 38 Jahre alt werden und eigenständig eine für ADHS spezialisierte Praxis aufsuchen, um die Diagnose zu erhalten. Hier möchte ich betonen, dass ich meiner Therapeutin keinen Vorwurf mache. Ich werde in einem Ausbildungszentrum therapiert und meine Therapeutin ich eine unglaublich engagierte Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Bevor ich allerdings einen Therapieplatz bei ihr erhielt, hatte ich bei anderen Therapeuten mein Erstgespräch und jeweils meinen Verdacht von ADHS angesprochen. Es war für die Therapeuten stets direkt klar, dass es sich um eine Überschneidung der Symptomatik von kPTBS handeln musste. Diese Denkweise macht leider auf einem Auge blind.
Ich stoße auf Social Media immer wieder auf Beiträge von Therapeuten, die behaupten, ADHS wäre die Folge von Traumata, was schlichtweg falsch ist. Anders herum wird da eher ein Schuh daraus. ADHS Betroffene erleiden häufiger Traumata und entwickeln leichter eine PTBS oder kPTBS. Es ist immens wichtig, auch immer ADHS und Autismus in Betracht zu ziehen. Die Komorbiditätsrate von ADHS und Autismus ist unheimlich groß. (3)
Meine persönliche Erfahrung mit der Therapie
Ich befinde mich wie erwähnt in einer kognitiven Verhaltenstherapie seit nun einem Jahr und bin äußerst zufrieden. Die Traumata haben wir angeschnitten, aber nicht vertieft. Das war meiner Meinung nach auch nicht notwendig. Ich habe ein tiefes Verständnis zu meinem Krankheitsbild gewinnen können und meine Flashbacks verringert. Kommt ein Flashback auf, weiß ich genau, was zu tun ist und kann die Dauer und Intensität verringern. Das alleine ist bereits eine große Entlastung.
Wir haben an meinen Glaubenssätzen gearbeitet, bin dabei immer mehr meine Bedürfnisse zu erkennen und Grenzen zu setzen, habe mir mehr Selbstvertrauen und Selbstwert erarbeitet und bin absolut stabil. Ob ich noch andere Methoden ausprobieren werde, weiß ich derzeit nicht. Vermutlich nicht. Jedenfalls nicht bei einem Therapeuten. Allerdings hat sich das Thema Psychologie als Spezialinteresse herauskristallisiert und ich werde vermutlich noch das ein oder andere Buch verschlingen und einiges ausprobieren. Beispielsweise DBT interessiert mich brennend. Ursprünglich wurde diese Methode zur Selbsthilfe konzipiert. Also, why not?
Schlusswort
Ich hoffe, ich konnte das Krankheitsbild kPTBS verständlich erklären. Wenn du an dieser Stelle Fragen dazu hast, oder ich auf etwas genauer eingehen soll, schreib es mir gerne in die Kommentare oder schreibe mir gerne eine E-Mail.
Liebe Grüße,
Tanja
Quellenangaben
- Buch; Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung von Luise Reddemann, Wolfgang Wöller, 2. Auflage.
- Dissertation der Universität München; Verhaltensauffälligkeiten und deren Abhängigkeit von potentiell traumatischen Lebensereignissen bei Kindern mit ADHS im Vergleich zu einer gesunden Vergleichsgruppe
- ADHS-Deutschland e.V.